
Hippocampus Kolumne 10
Eine Replik auf den kritischen Beitrag von Kai Gondlach, verfasst von Matthias Pietzcker, geschäftsführender Gesellschafter von combine.
In diesen Wochen haben wir einen kritischen Gastkommentar des Leipziger Zukunftsforschers Kai Gondlach veröffentlicht, in dem die Purpose-Debatte als „entweder inhaltsleer“ oder als „Perversion der Arbeitskultur“ bezeichnet wird. Letztendlich werde versucht, „Arbeit möglichst mit dem Privatleben der Beschäftigten zu matchen“. Diese „Vorstellung einer Mischung aus Stepstone und Tinder“ sei jedoch „nichts mehr als eine Illusion“, die dazu diene, die Zufriedenheit und somit die Produktivität der Arbeitskraft zu erhöhen.
Wie wir zu diesen Aussagen stehen? Gondlachs Text enthält aus unserer Sicht einige wichtige und berechtigte Kritikpunkte. Gleichzeitig zwingt ihn das Format des kritischen Kommentars in ein polemisches Korsett, das seinen Argumenten nicht immer gerecht wird.
Das wird zum Beispiel sichtbar, wenn er behauptet, dass eine „100-Prozent-Übereinstimmung in puncto Werte, Ziele oder Sinn“ zwischen Unternehmen und Belegschaft unmöglich ist, oder wenn er als warnendes Beispiel für Purpose-Washing ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen imaginiert, das jemanden beschäftigt, der „zwar irgendwie auch Nachhaltigkeit gut und Klimakatastrophe blöd findet, aber gern Fleisch konsumiert und gelegentlich in den Urlaub fliegt.“
Purpose ist kein Dogma.
Nun dürften selbst unter den Millionen Menschen, die eine engagierte Umweltorganisation wie Greenpeace unterstützen, mehr als eine Handvoll dieser Beschreibung entsprechen. Und sogar im engsten Kern der 2.400 Mitarbeiter:innen von Greenpeace werden welche zu finden sein, die manchmal Fleisch essen, oder – eventuell sogar im Auftrag der Organisation – ab und zu in ein Flugzeug steigen. Aber würde jemand ernsthaft deshalb Greenpeace einen Purpose absprechen? Wohl kaum. Denn eine „100-Prozent-Übereinstimmung“ zwischen Ideal und Realität ist tatsächlich unmöglich – selbst in militanten Organisationen, geschweige denn in großen Konzernen.


Höchstens religiöse oder politische Dogmen erheben den Anspruch auf eine makellose Übereinstimmung von Ideal und Realität – und die Geschichte hat gezeigt, dass Versuche, einen solchen totalitären Anspruch kompromisslos umzusetzen, meist ein grausames Ende nehmen. Doch Purpose ist glücklicherweise kein Dogma, sondern ein Ziel, das sich Unternehmen setzen können. Und soweit dieses klar formuliert ist, können Arbeitnehmer:innen eigenständig entscheiden, welchen Identifikationsgrad sie mit diesem eingehen wollen.
Purpose ist nicht gleich Purpose.
Der Purpose-Economy-Theoretiker Aaron Hurst unterscheidet zwischen drei Typologien von Unternehmen:
- Wertegetrieben („Value-Driven“): Unternehmen, die sich ausdrücklich auf bestimmte Werte beziehen und diese als Entscheidungskriterium für ihr Handeln nehmen. Der US-amerikanische Eishersteller Ben & Jerry’s gehört ebenso dieser Kategorie an wie der Naturkosmetik-Hersteller Weleda.
- Exzellenzgetrieben („Excellence-Driven“): Unternehmen, deren Ziel es ist, in ihrer Branche hohe Standards in Sachen Qualität und Innovation zu setzen. Kultmarken mit starker Ausstrahlungskraft wie Apple oder Porsche können dieser Kategorie zugerechnet werden.
- Impactgetrieben („Impact-Driven“): Unternehmen, die stets bestrebt sind, die negativen gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen ihres Handelns zu minimieren und idealerweise sogar ins Positive zu wenden. Der Outdoor-Bekleidungshersteller Patagonia wird hier gerne als Best-Practice-Beispiel genannt.
Diese Kategorisierung zeigt, dass Purpose viele Facetten hat und keineswegs Unternehmen dazu zwingt, ihre Identität aufzugeben – im Gegenteil. Die Definition von klaren Zielen bringt sowohl für die Unternehmen selbst wie auch für potenzielle Kund:innen und Arbeitnehmer:innen eine Reihe bedeutender Vorteile.
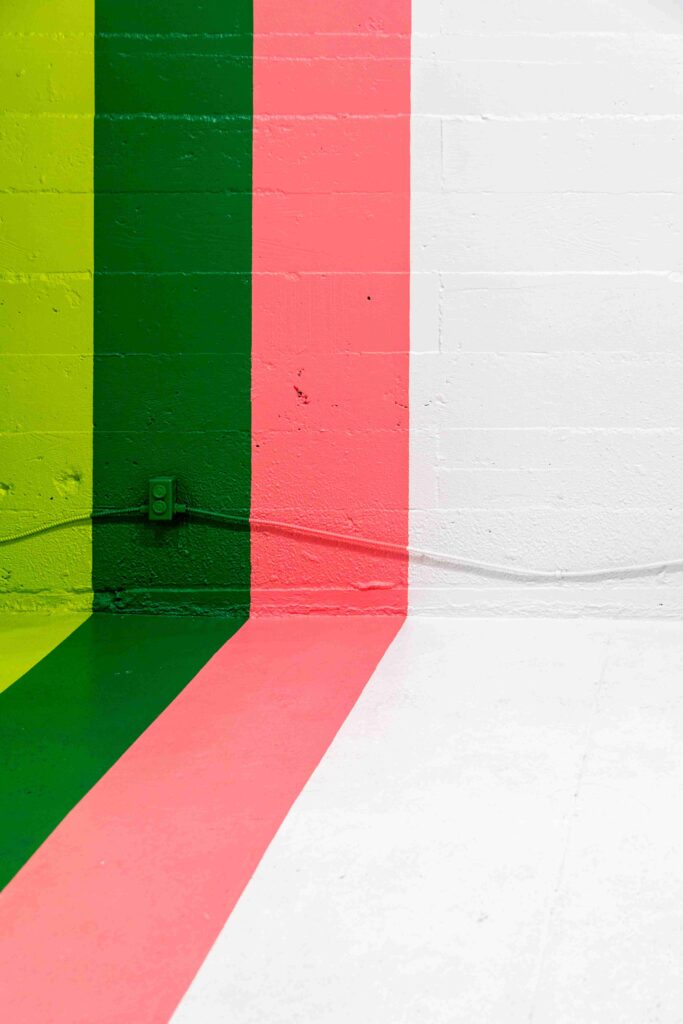


Purpose gehört die Zukunft.
Wirtschaft und Gesellschaft werden mit Hinblick auf den Klimawandel massive Veränderungen durchmachen müssen. Gleichzeitig glauben viele Beobachter:innen, dass dies nicht ohne massive staatliche Regelung passieren wird. Diese Ansicht mag grundsätzlich richtig sein. Es scheint aber fraglich, ob solche gesetzlich verordneten Eingriffe erfolgreich sein werden, solange der Sinn von Unternehmen mit Wachstum gleichgesetzt wird. Hier wird ein Widerspruch erkennbar: Einerseits wird gerne behauptet, dass der einzig wahre Unternehmenssinn die Schaffung von Profit sei – was die gesamte Purpose-Bewegung auf das Niveau einer PR-Maßnahme herabstufen würde. Andererseits müssen selbst marktfreundliche Beobachter:innen zusehends eingestehen, dass eine dauerhafte Ausrichtung auf reine Gewinnmaximierung nicht zukunftsfähig ist.
Einen möglichen Ausweg aus solchen Widersprüchen bietet die Arbeit der englischen Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth: Als Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit hat sie das Konzept der „Donut Ökonomie“ entwickelt. Darunter versteht sie ein neues Wirtschaftsmodell, das mit dem Wachstumsdogma bricht und eine Reihe neuartiger Parameter definiert, um wirtschaftlichen Erfolg zu messen. Anhand von zwölf gesellschaftlichen und neun ökologischen Kriterien werden dem Wachstum explizit Grenzen gesetzt, die in der von Raworth vorgeschlagenen grafischen Darstellung die Form eines Rings annehmen (daher „Donut“). Unter einem solchen Modell ist nicht mehr Profit das ausschlaggebende Erfolgskriterium, sondern der Impakt unternehmerischen Handelns – also seine konkreten Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Mehr Purpose geht kaum.



Über Sinn und Unsinn der Arbeit.
Seine Großkinder würden nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssen, prophezeite der Wirtschaftswissenschaftler Jon Maynard Keynes im Jahr 1930. So ist es bekanntlich nicht gekommen, über die Gründe streiten Ökonomen bis heute. Die Idee einer 15-Stunden-Woche ist jedoch in den letzten Jahren auch dank New-Work-Vordenker:innen wie Rutger Bregman wieder in Mode gekommen, oft verbunden mit der Idee eines universellen Grundeinkommens. Was hat das mit Purpose zu tun? Sehr viel, wenn man den Thesen des Anthropologen David Gräber Glauben schenkt. In seinem Buch „Bullshit Jobs“, das auf einem vielbeachteten Artikel aus dem Jahr 2013 basiert, behauptet Gräber, dass die 15-Stunden-Woche von Keynes inzwischen technisch möglich sei, aber nicht umgesetzt werde.
Da ein Großteil unserer gesellschaftlichen Strukturen auf der Idee der bezahlten Arbeit basiere, seien über die Jahre zahlreiche künstliche Tätigkeiten entwickelt worden, um ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen. Diese seien jedoch „so vollständig sinnlos, unnötig oder schädlich (…), dass sogar die Beschäftigten selbst die Existenz der Beschäftigung nicht rechtfertigen können, auch wenn die Beschäftigten sich durch ihre Arbeitsbedingungen gezwungen fühlen, dies nicht zuzugeben“, erklärt Gräber.
Ob man diese provokante These nun befürworten will oder nicht: Wir sollten die Utopie einer Arbeitswelt, die von größerer Sinnhaftigkeit geleitet wird, nicht aufgeben. Denn Arbeit kann nicht nur sinnstiftend sein. In einer Welt, in der das Fortbestehen unserer Gesellschaft maßgeblich von unserem Handeln in den kommenden Jahren abhängt, muss sie das sogar sein.
Fotos: iStock, Pexels, Unsplash




